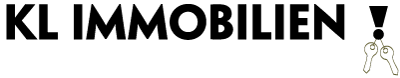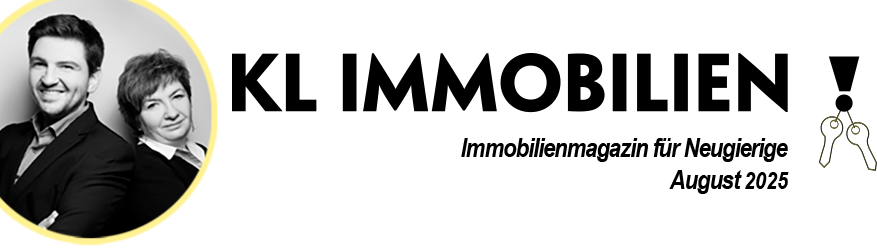
KOMMUNALER LEBENSWANDEL
Unsere Stadt – gestern und heute

Ansichtskarte: Reinhard Gebauer
Auf der alten Ansichtskarte mit Poststempel vom 8.5.1911 ist der Gasthof „Zum Bahnhof“ von Heinrich Scherer zu sehen. Das prachtvolle Gebäude stand an der Ecke Clever Straße 1/Bahnstraße 1 (heute: Schmachtendorfer Straße/Weseler Straße) am Bahnhof Holten.

Text und Foto: Reinhard Gebauer
Eine Ansicht vom 19.07.2025 zeigt die heutige Situation. Die Bahnunterführung im Zuge der Schmachtendorfer Straße wurde im Jahr 1984 fertiggestellt, da war die alte Gaststätte bereits abgerissen.
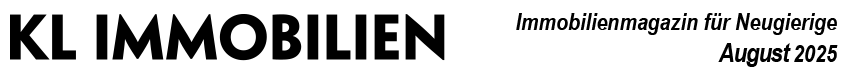
KOMPETENTE LÖSUNGEN
Anfechtungsverfahren: Darf Verwalter entlastet werden?

Besonders wichtig: Auch wenn im Verwaltervertrag steht, dass er nur für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet, ist dieser Schutz nicht automatisch wirksam. In Formularverträgen kann die Haftung für einfache Fahrlässigkeit nicht vollständig ausgeschlossen werden – solche Klauseln sind unwirksam.
Zudem gilt: Ein Verwalter muss nicht verhindern, dass Eigentümer unklare oder rechtlich problematische Beschlüsse fassen. Er muss jedoch klar darauf hinweisen, wenn ein Beschluss möglicherweise anfechtbar oder sogar nichtig ist. Unterlässt er diese Aufklärung, kann er im Zweifel haftbar gemacht werden.
Entlastungen sollten mit Bedacht erfolgen – nicht während laufender Verfahren. Und Verwalter sind gut beraten, Eigentümer rechtzeitig über mögliche Risiken aufzuklären. So lassen sich Streitigkeiten und Haftungsrisiken vermeiden.
LG Frankfurt am Main, Urteil vom 20.02.2020, Az. 2-13 S 94/19
Beschluss nicht verständlich formuliert: Ist der Verwalter schadenersatzpflichtig?
Ein Verwalter muss bei kostenintensiven Maßnahmen besonders sorgfältig arbeiten – das bestätigt ein Beschluss des Landgerichts Stuttgart. In dem Fall hatte der Verwalter zur Eigentümerversammlung eingeladen und angekündigt, dass über einzelne Dachreparaturen beraten werden solle. Tatsächlich beschlossen die Eigentümer dann die Sanierung aller sechs Dächer – samt Sonderumlage von 375.000 Euro.
Ein Eigentümer focht den Beschluss an – mit Erfolg. Das Gericht stellte fest: Die Tagesordnung war nicht ausreichend konkret. Bei größeren Ausgaben müssen Eigentümer genau wissen, worüber abgestimmt werden soll und welche finanziellen Folgen das für sie hat. Weil der Verwalter dies versäumt hatte, wurde ihm grobes Verschulden vorgeworfen. Folge: Er muss die Kosten des Anfechtungsverfahrens selbst tragen.
Das Urteil zeigt: Bei wirtschaftlich bedeutsamen Entscheidungen reicht eine vage Ankündigung in der Einladung nicht aus. Der Verwalter muss den Beschlussgegenstand klar und verständlich formulieren, damit alle Eigentümer eine fundierte Entscheidung treffen können. Ein Verstoß kann teuer werden – nicht nur für die Gemeinschaft, sondern auch für den Verwalter persönlich.
LG Stuttgart, Urteil vom 07.08.2019, Az. 19 T 394/18
Kann ein einziger Eigentümer den Verwalter abberufen?
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil klargestellt, unter welchen Voraussetzungen ein einzelner Wohnungseigentümer die Abberufung des Verwalters verlangen kann. Seit der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes zum 1. Dezember 2020 ist die Abberufung eines Verwalters jederzeit möglich. Ein wichtiger Grund ist nicht mehr erforderlich. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein einzelner Eigentümer einen Anspruch auf die Abberufung hat, nur weil er persönlich mit der Arbeit des Verwalters unzufrieden ist.
Vielmehr bleibt es auch nach der Reform dabei, dass die Fortsetzung des Verwalteramts aus objektiver Sicht nicht mehr vertretbar sein muss. Das Gericht prüft dabei, ob das Festhalten am Verwalter unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls unzumutbar erscheint. Dabei können auch ältere Pflichtverletzungen berücksichtigt werden, sofern sie das Vertrauensverhältnis nachhaltig erschüttert haben. Eine einzelne Unstimmigkeit oder ein bloßer Meinungsunterschied reichen in der Regel nicht aus, um eine gerichtliche Abberufung zu rechtfertigen.
Der BGH stellt damit klar, dass die gesetzlich eröffnete Möglichkeit der jederzeitigen Abberufung in der Praxis nur durch die Mehrheit der Eigentümer umgesetzt werden kann. Einzelne Eigentümer sind auf den Weg über die Beschlussersetzungsklage angewiesen, müssen dann aber überzeugend darlegen, dass die Gemeinschaft durch das Verhalten des Verwalters ernsthaft geschädigt oder gefährdet wird. Das Urteil schützt damit sowohl die Verwalter vor unbegründeten Einzelinitiativen als auch die Gemeinschaft vor einem Festhalten an nicht mehr tragbaren Verwaltungsverhältnissen.
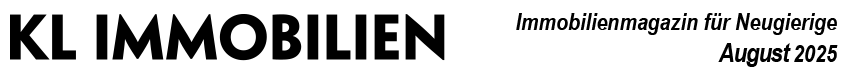
KAUF LAUNE
Verkäufer:
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? Hier finden Sie Ankaufsprofile, die Käufer selbst veröffentlicht haben.
– Eigentumswohnungen
– Ein- und Zweifamilienhäuser
– Mehrfamilienhäuser
Käufer:
Veröffentlichen Sie Ihr Ankaufsprofil, das für potenzielle Verkäufer sichtbar ist – Ihre Vorteile auf einen Blick.
Login: kl-immo-web.de/login
Kostenlose Wertermittlung – Präzise Marktwertanpassung – Erfolgreicher Verkauf!
Planen Sie, Ihre Immobilie demnächst zu verkaufen? Kontaktieren Sie uns!
Möchten Sie wissen, was Ihre Immobilie wert ist? Wertermittlung
So verkaufen wir Ihre Immobilie: weiterlesen
So vermieten wir Ihre Immobilie: weiterlesen
KLING LUSTIG

Kunde: „Dieses Haus gefällt mir sehr gut. Gibt es irgendetwas, das ich wissen sollte?“
Makler: „Ja, Sie sind bereits der zehnte Kunde, dem ich sage, dass er der Erste ist.“
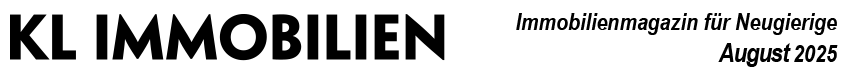
KAPITAL LANDSCHAFT
Heizung nach Immobilienkauf: Diese Austauschpflichten gelten für neue Eigentümer

Konkret bedeutet das: Öl- oder Gasheizkessel, die älter als 30 Jahre sind und nicht als moderne Brennwert- oder Niedertemperaturgeräte eingestuft werden, dürfen nicht weiter betrieben werden. Wurde die Heizung zum Beispiel 1993 eingebaut, muss sie spätestens bis 2023 ausgetauscht werden. Kaufen Sie ein solches Gebäude im Jahr 2025, beginnt Ihre Frist ab dem Eigentumsübergang – Sie haben dann bis 2027 Zeit, die Heizung zu ersetzen. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob Sie selbst in der Immobilie wohnen oder sie vermieten.
Wichtig ist deshalb: Prüfen Sie vor dem Kauf oder Verkauf unbedingt, wie alt die Heizungsanlage ist und um welchen Typ es sich handelt. Nur Brennwert- oder Niedertemperaturkessel sind von der Austauschpflicht ausgenommen. Ein rechtzeitiger Austausch schützt nicht nur vor möglichen Bußgeldern, sondern eröffnet auch den Zugang zu attraktiven Förderprogrammen – etwa beim Umstieg auf eine Wärmepumpe, Hybridlösung oder eine andere klimafreundliche Heiztechnik.
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Heizung betroffen ist, oder Unterstützung bei der Bewertung und Planung benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter. So sorgen Sie für langfristige Sicherheit und Wertstabilität Ihrer Immobilie – und erfüllen gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen.
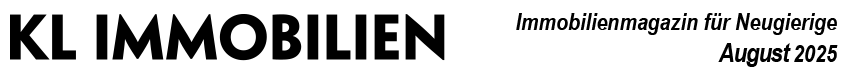
KUNTERBUNTES LAND
Jakob Plum – Der Mann, der Heimat schuf
Ein Pionier des genossenschaftlichen Bauens in bewegter Zeit
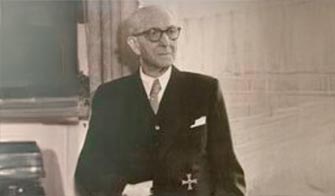
Jakob Plum geb.1879 gest. am 18. August 1954
In einer Zeit, als Wohnraum für viele Menschen ein Luxus war, und das Dach über dem Kopf keineswegs selbstverständlich – da trat ein Mann auf den Plan, der sein Leben der Idee widmete, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Jakob Plum, geboren 1879, war kein Architekt, kein Bauträger im heutigen Sinn – und doch hat er das Gesicht ganzer Stadtteile im Ruhrgebiet geprägt.
Plum war Eisenbahner. Aber er war auch Visionär, Organisator und Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Er erkannte früh, dass nur gemeinschaftlicher Mut, Weitblick und Zusammenhalt der grassierenden Wohnungsnot etwas entgegensetzen konnten. Und so gründete er 1904 in Osterfeld die Spar- und Bauverein e.G.m.b.H., einen genossenschaftlichen Zusammenschluss, der Familien mit wenig Einkommen ein würdiges Zuhause schaffen sollte.
Was folgte, war kein gewöhnliches Bauprojekt – es war ein sozialer Aufbruch in Ziegeln gegossen. Häuser an der Mittelstraße, der Greenstraße, der Beckstraße, später ganze Siedlungen: solide gebaut, funktional durchdacht und voller Leben. Hier wurde kein Beton gegossen, hier wurde Verantwortung verankert. Es waren Siedlungen für Arbeiter, für Witwen, für Kriegsrückkehrer – und für eine Gesellschaft, die ihren sozialen Zusammenhalt nicht aufgab, selbst in Zeiten von Krieg, Inflation, Diktatur und Not.
Jakob Plum ließ sich nicht aufhalten. Nicht von Bürokratie. Nicht von politischen Repressionen. Und nicht von der Armut, die ihn täglich umgab. Mit jedem Bauabschnitt wuchs nicht nur das Wohnangebot, sondern auch das Vertrauen der Menschen in ein anderes Modell von Stadtentwicklung: nachhaltig, solidarisch und menschenzentriert.
Dass heute eine Straße seinen Namen trägt – die Jakob-Plum-Straße in Oberhausen – ist kein Zufall. Sie wurde schon zu Lebzeiten benannt, eine außergewöhnliche Geste. Und sie erinnert uns: An einen Mann, der mit nichts als Entschlossenheit, Gemeinsinn und Weitblick eine Siedlungsbewegung formte, die bis heute wirkt. Noch immer ist die von ihm gegründete Genossenschaft aktiv – mit über 4.500 Wohnungen in mehreren Städten.
1953, kurz vor seinem Tod, wurde Jakob Plum mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Theodor Heuss ehrte ihn mit den Worten:
„Ihr Werk ist eine Symphonie des Schaffens, getragen von sozialer Friedensliebe in einem echten Freiheitsdenken.“
Durchschnittliche Preise pro m², Quelle Immobilienscout
46117 Oberhausen-Osterfeld, Jakob-Plum-Straße
8,18 €/m² – Mietwohnungen
2.205,00 €/m² – Eigentumswohnungen
3.042,00 €/m² – Häuser
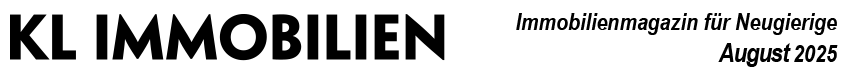
KURZE LEKTÜRE
Was macht der Notar nach dem Immobilienkaufvertrag?
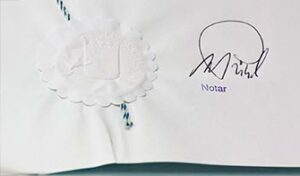
Zunächst sorgt der Notar dafür, dass eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen wird. Sie schützt den Käufer davor, dass die Immobilie doppelt verkauft oder mit neuen Belastungen versehen wird.
Dann prüft der Notar, ob alle Bedingungen für die Zahlung erfüllt sind – zum Beispiel die Löschung alter Grundschulden oder notwendige Genehmigungen. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, informiert der Notar den Käufer schriftlich mit der sogenannten Fälligkeitsmitteilung.
Gleichzeitig meldet der Notar den Kauf ans Finanzamt. Erst wenn die Grunderwerbsteuer gezahlt ist, darf der Käufer als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen werden.
Zum Schluss veranlasst der Notar die Eigentumsumschreibung, erstellt alle notwendigen Abschriften und übergibt Unterlagen auch an Banken oder Behörden.
Der Notar sorgt nicht nur für einen rechtssicheren Vertrag – er begleitet den gesamten Prozess bis zur Eintragung als Eigentümer und schützt Käufer vor rechtlichen Risiken.
Wer zahlt den Notar beim Immobilienkauf – und wie viel kostet das?
Wer eine Immobilie kauft, kommt um den Gang zum Notar nicht herum. Doch viele Käufer stellen sich die Frage: Wer übernimmt eigentlich die Notarkosten? Die Antwort ist klar: In der Regel zahlt der Käufer.
Diese Praxis ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat sich aber bundesweit durchgesetzt – und wird fast immer im Kaufvertrag festgehalten. Der Grund ist nachvollziehbar: Der Käufer hat das größte Interesse daran, dass der Eigentumsübergang rechtssicher abgewickelt wird.
Doch wie teuer ist der Notar beim Immobilienkauf? Die Kosten richten sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und hängen vom Kaufpreis ab. Als Faustregel gilt: Notarkosten und Grundbuchgebühren zusammen machen etwa 1,5 bis 2 Prozent des Kaufpreises aus.
Beim Immobilienkauf trägt in der Regel der Käufer die Notarkosten. Diese sollten frühzeitig in die Gesamtkalkulation der Kaufnebenkosten einbezogen werden – ebenso wie Grunderwerbsteuer und Maklerprovision.
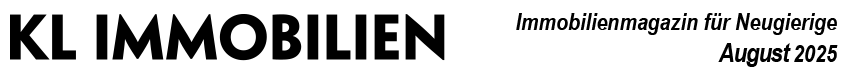
KURIOSE LIEGENSCHAFTEN
In Soest, einer der ältesten Städte Nordrhein‑Westfalens, steht das markante Pilgrimshaus, das heute als Hotel und Restaurant dient. Gegründet im Jahr 1304, gilt es als das älteste durchgehend genutzte Gebäude des Landes und ist seit 2005 offiziell Denkmal des Monats in NRW.

Das Pilgrimshaus steht exemplarisch für die Bedeutung historischer Bauten in NRW – als lebende Zeugnisse regionaler Bau- und Kulturgeschichte. Wer das Haus betritt, spürt die Kontinuität von über 700 Jahren Nutzungsgeschichte – von mittelalterlicher Pilgerherberge zum charmanten Hotelbetrieb im 21. Jahrhundert.
Das Pilgrimshaus zeigt, wie historische Gebäude nicht nur bewahrt, sondern auch heute wirtschaftlich genutzt werden können. Für Eigentümer und Investoren im Immobilienbereich ist es ein herausragendes Beispiel dafür, wie Denkmalschutz und zeitgemäße Nutzung Hand in Hand gehen können.